Einblick in die Evolution von Proteinen
ETH-Forschende blicken mehrere Milliarden Jahre zurück in die Zeit, als das Leben auf der Erde im Entstehen begriffen war. In einem Experiment untersuchten sie, wie sich ein primitives Protein evolutiv verbessern konnte. Der Blick zurück ermöglichte den Wissenschaftlern zudem einen Ausblick in die Zukunft der synthetischen Biologie.
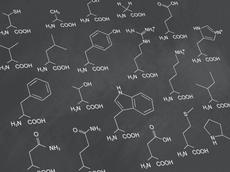
Das Leben entstand nicht von heute auf morgen. Die ersten primitiven Lebensformen, die sich vor etwa vier Milliarden Jahren auf der Erde entwickelten, hatten noch wenig gemeinsam mit heutigen Organismen. Wahrscheinlich kamen sie noch ohne Proteine aus. Und auch die ersten Proteine, die sich in den folgenden paar hundert Millionen Jahren bildeten und zu wichtigen Bestandteilen der belebten Welt wurden, unterschieden sich von den heutigen: Wissenschaftler gehen davon aus, dass die ersten Proteine aus einem reduzierten Bausatz von nur sieben oder acht verschiedenen Aminosäuren zusammengesetzt waren. Der Bausatz heutiger Proteine umfasst gut 20 Aminosäuren.
Forschende unter der Leitung von Donald Hilvert, Professor am Laboratorium für Organische Chemie, haben nun in einem Experiment nachgestellt, wie sich der anfänglich minimale Aminosäuren-Bausatz im Laufe der Evolution erweitert haben könnte. Aus ihrer Arbeit ziehen die Forscher nicht nur Schlüsse bezüglich der Vergangenheit, sondern gewinnen auch wichtige Erkenntnisse für zukünftige Stossrichtungen in der synthetischen Biologie.
Evolution eines vereinfachten Enzyms
Die ETH-Forscher führten Evolutionsexperimente mit einem künstlichen Protein durch, das sie vor einigen Jahren in ihren Labors entwickelt haben. Es ist einem real existierenden Enzym nachgeahmt, einer sogenannten Chorismatmutase. Das real existierende Enzym besteht jedoch aus allen 20 Aminosäuren, das künstliche Protein aus einem reduzierten Bausatz von nur neun Aminosäuren. «Unsere künstliche Chorismatmutase hat dieselbe Funktion wie die natürliche, ist allerdings weniger stabil und weniger aktiv», sagt Hilvert.
Die Wissenschaftler untersuchten nun, inwieweit man das vereinfachte Protein optimieren kann, und wie es sich konkret verhält, wenn man ihm erlaubt, den Aminosäuren-Bausatz zu erweitern – genauso, wie es auch während der Evolution geschehen sein dürfte. Dazu haben sie das dem Protein entsprechende Gen in Bakterien eingebaut, die keine natürliche Chorismatmutase enthalten. Die Wissenschaftler liessen diese Bakterien eineinhalb Monate lang in einem Bioreaktor wachsen. Dabei kam es natürlicherweise zu Mutationen im Erbgut. Anschliessend untersuchten die Forscher, inwieweit sich das künstliche Protein beziehungsweise sein Gen verändert hat.
Überraschenderweise nur geringe Veränderungen
Tatsächlich haben sich Gen und Protein im Experiment verändert – nur geringfügig zwar, jedoch mit grossen Auswirkungen: Die enzymatische Aktivität des Proteins und seine Stabilität haben zugenommen. Dass die Veränderungen in der Abfolge der Aminosäuren vergleichsweise gering waren, hat die Wissenschaftler überrascht. Das Protein besteht aus knapp 100 einzelnen Aminosäuren, nur zwei davon veränderten sich. An einer Stelle wurde die Aminosäure Isoleucin durch die Aminosäure Threonin ersetzt, an einer anderen Stelle Leucin durch Valin. «Das sind strukturell nur ganz geringe Veränderungen, denn die neuen Aminosäuren unterscheiden sich nicht grundlegend von jenen, die sie ersetzen», sagt Hilvert. Die Wissenschaftler hätten eine viel höhere Zahl an teils grossen Veränderungen erwartet. «Auch wenn die zwei Veränderungen sehr konservativ sind, konnten wir zeigen, dass sie dem Protein einen klaren Selektionsvorteil bringen», sagt Hilvert.
Erkenntnisse für die synthetische Biologie
Die Arbeit der ETH-Wissenschaftler gibt nicht nur Einblick in die Geschichte der Evolution, wie sie sich vor fast vier Milliarden Jahren schon einmal hätte abspielen können. Die Forscher ziehen daraus auch Schlüsse für zukünftige Aktivitäten im Bereich der synthetischen Biologie. In diesem Forschungsfeld geht es unter anderem darum, die Funktionalität von Organismen oder Proteinen durch natürlich nicht vorkommende Moleküle zu erweitern.
Bereits heute kommt in Medizin und Industrie eine ganze Reihe von künstlich hergestellten Enzymen zum Einsatz. In Zukunft könnten diese beispielsweise nicht nur aus den gut 20 natürlichen Aminosäuren aufgebaut sein, sondern zusätzlich aus synthetischen Aminosäuren. Von einem grösseren Bausatz erhofft man sich mehr Möglichkeiten im Design künstlicher Enzyme, beispielsweise was deren katalytische Funktionalität angeht. Zudem erwartet man, dass Enzyme aus künstlichen Aminosäuren unter Umständen im Körper oder in einem Fabrikationsprozess langsamer abgebaut werden. Bei gewissen medizinischen oder industriellen Anwendungen ist dies sehr vorteilhaft.
«Eine Lehre aus dieser Arbeit ist, dass man bei der Weiterentwicklung des Aminosäuren-Bausatzes in der synthetischen Biologie nicht nur an spektakuläre künstliche Aminosäuren denken sollte», sagt Peter Kast, Professor am Laboratorium für Organische Chemie, der ebenfalls an der Arbeit beteiligt war. «Auch Aminosäuren mit geringen Unterschieden zu natürlichen könnten sich als sehr nützlich erweisen.»
Warum benützt die Biologie «nur» gut 20 Aminosäuren?
Der genetische Code, der allem heutigen Leben auf der Erde
zugrunde liegt, würde eigentlich mehr als die 20 universellen Aminosäuren
erlauben, die er umfasst. Denn die einzelnen Aminosäuren von Proteinen sind auf
der Ebene der Gene in einer Abfolge von jeweils drei sogenannten Basen (einem
Basen-Triplet) codiert. Das Alphabet der Erbsubstanz DNA besteht
aus vier unterschiedlichen Basen. Die Zahl möglicher Triplets aus diesen vier
Basen ist 64 (4 hoch 3). Mit dem genetischen Code könnte man also bis zu 64
verschiedene Aminosäuren beschreiben. Stattdessen setzt die Natur auf «nur» gut
20 Aminosäuren und einen redundanten Code: die einzelnen Aminosäuren sind
jeweils durch mehrere Triplets beschrieben. Warum eigentlich?
Ein Grund dürfte darin liegen, dass diese Redundanz die
Auswirkungen von Mutationen in der DNA abfedert, was während der Evolution
offenbar von Vorteil war. «Mit dem Bausatz von 20 universellen Aminosäuren hat
die Evolution ein momentanes Optimum erreicht», sagt ETH-Professor Donald
Hilvert.
Neben den 20 universellen Aminosäuren kommt heute bei vielen
Lebewesen, auch beim Menschen, eine 21. Aminosäure namens Selenocystein vor.
Bei bestimmten Mikroorganismen, den Archaeen, gibt es zudem eine 22. Aminosäure:
Pyrrolysin. Der Einbau dieser beiden zusätzlichen Aminosäuren in Proteine ist
komplexer als jener der 20 universellen Aminosäuren. Daraus schliessen
Wissenschaftler, dass sich der genetische Code in den letzten Milliarden Jahren
evolutiv verändert hat. Hilvert: «Abgeschlossen ist die Evolution jedoch nicht.
Es ist gut möglich, dass in deren weiteren Verlauf zusätzliche Aminosäuren in
den Code aufgenommen werden.»
Literaturhinweis
Müller MM, Allison JR, Hongdilokkul N, Gaillon
L, Kast P, van Gunsteren WF, Marlière P, Hilvert D. Directed Evolution of a
Model Primordial Enzyme Provides Insights into the Development of the Genetic
Code. PLOS
Genetics, 2013, 9: e1003187, doi: 10.1371/journal.pgen.1003187








LESERKOMMENTARE